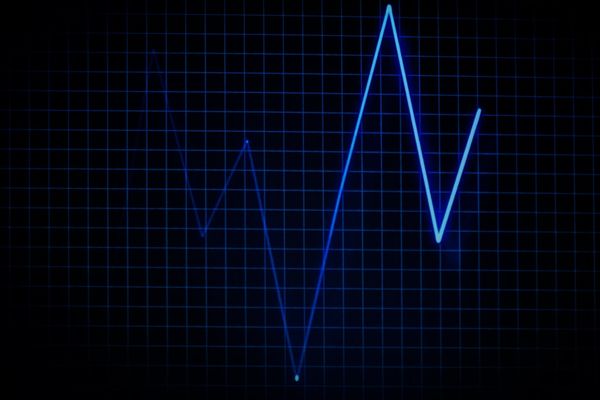Konjunkturzyklus: Wie wirkt er sich auf deine Geldanlagen aus?
Konjunkturwissenkennzahlwirtschaftdigital economy
Du hast in Aktien oder einen ETF investiert und wunderst Dich, dass der Kurs auf einmal stark abrutscht? Ein Grund dafür kann der Konjunkturzyklus sein. Er tritt in Deutschland und anderen Volkswirtschaften auf und ist durch vier Phasen geprägt. An verschiedenen Indikatoren kannst Du ihn erkennen.

Was ist der Konjunkturzyklus?
Der Konjunkturzyklus ist ein zentraler Begriff in der Volkswirtschaft und informiert über die wirtschaftliche Lage eines Landes. Der Zyklus ist durch die vier Phasen
- Aufschwung (Expansion)
- Hochkonjunktur (Boom)
- Abschwung (Rezession)
- Tiefphase (Depression)
geprägt. Auf- und Abschwünge sind in einem normalen konjunkturellen Umfeld völlig normal. Unabhängig voneinander können innerhalb einer Volkswirtschaft wie Deutschland verschiedene Branchen unterschiedliche Konjunkturphasen durchlaufen. Diese Branchen werden in der Summe über die ganze Volkswirtschaft betrachtet. Im Rahmen des Bruttoinlandsproduktes (BIP) können sie interpretiert werden.
Zur Einschätzung der Konjunktur einer Volkswirtschaft muss die Auslastung des vorhandenen Produktionspotentials herangezogen werden. In jeder Volkswirtschaft ist ein bestimmtes Maß an Produktionskapazitäten vorhanden. Abhängig von der Nachfrage am Markt können diese Kapazitäten in unterschiedlichem Ausmaß genutzt werden. Die einzelnen Phasen im Konjunkturzyklus kündigen sich mit bestimmten Indikatoren an. Um eine schwache Konjunktur handelt es sich, wenn die vorhandenen Kapazitäten nur in geringem Maße genutzt werden. Eine starke Konjunktur liegt vor, wenn die Kapazitäten stark ausgelastet sind. Um die Konjunktur einzuschätzen, wird zumeist eine Entwicklung dargestellt. Die Auslastung wird im Vergleich zu einem anderen Zeitraum beschrieben, meistens über einen Zeitraum von einem Jahr.
Die Konjunktur entwickelt sich in eine bestimmte Richtung. Die Konjunkturzyklen wiederholen sich.

Der Konjunkturzyklus und seine Phasen
Die vier Phasen im Konjunkturzyklus sind durch bestimmte Merkmale gekennzeichnet und machen sich mit bestimmten Indikatoren bemerkbar.
Der Aufschwung, auch Expansion genannt, ist durch eine steigende Zahl an Aufträgen und damit verbunden eine stärkere Auslastung der Produktionskapazitäten gekennzeichnet. Vor allem in den Schlüsselindustrien wie Autoindustrie, Bauhauptgewerbe und Maschinenbau ist eine höhere Zahl an Aufträgen zu beobachten. Die Arbeitslosenzahl geht zurück, die Zahl der Erwerbstätigen nimmt zu. Während des Aufschwungs steigen auch die Zinsen und die Preise. Diese Steigerungen sind zuerst nur gering.
In der Hochkonjunktur, auch als Boom bezeichnet, erreicht der Konjunkturzyklus seinen Höhepunkt. Diese Phase ist durch eine volle Auslastung der Produktionskapazitäten, eine starke Nachfrage, Vollbeschäftigung oder sogar Überbeschäftigung gekennzeichnet. Das führt zu steigenden Löhnen sowie Gehältern und damit verbunden auch zu Preissteigerungen. Auch die Zinsen steigen. In dieser Phase besteht die Gefahr einer Inflation. Das Bruttoinlandsprodukt flacht in dieser Phase ab. Es gibt oft schon Indikatoren für einen Abschwung, die nächste Phase im Konjunkturzyklus. Um zu verhindern, dass die Wirtschaft eines Landes wie Deutschland zu stark einbricht, kommt es darauf an, die Indikatoren zu erkennen und auf den Übergang zu reagieren.
Der Abschwung, auch als Rezession bezeichnet, ist durch ein Ende der Vollbeschäftigung und ein Zurückfahren der Produktionskapazitäten geprägt. Die Arbeitslosigkeit steigt wieder. Die Nachfrage geht zurück. Auch die von den Unternehmern betriebenen Investitionen gehen zurück. Die Preise und die Zinsen sinken, mit der Wirtschaft geht es bergab. Um einen starken Rückgang der Wirtschaft zu verhindern, kann der Staat mit Subventionen eingreifen oder die Notenbanken die Zinsen senken. Sinkende Zinsen für Kredite können die Wirtschaft wieder ankurbeln, da Kredite zum Investieren genutzt werden können.
Kennzeichnend für den Tiefpunkt oder die Depression sind geringe Auslastung der Produktionskapazitäten und hohe Arbeitslosigkeit. Die Nachfrage nach Krediten geht zurück. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt. Da die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen sinkt, sinken auch die Preise. Merken die Verbraucher, dass die Preise während der Depression nicht noch weiter sinken, steigt die Nachfrage wieder. An die Depression schließt sich der Aufschwung an. Der Konjunkturzyklus beginnt von vorn.
Arten von Konjunkturzyklen in der Volkswirtschaftslehre
In der Volkswirtschaftslehre werden drei Arten von Konjunkturzyklen unterschieden:
Saisonale Schwankungen
Die saisonalen Schwankungen dauern nur wenige Monate und betreffen nur Teilbereiche einer Volkswirtschaft wie Deutschland. Solche saisonalen Trends sind beispielsweise die Spargelernte bei den Spargelbauern, das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel oder schneereiche Winter in der Gastronomie in Wintersportorten.
Saisonale Schwankungen sind jahreszeitlich bedingt. Sie betreffen nur wenige oder einzelne Wirtschaftszweige. Da sie vorhersehbar sind, können sich Unternehmen darauf einstellen.
Konjunkturelle Schwankungen
Konjunkturelle Schwankungen treten meistens mittelfristig auf. Sie betreffen die gesamte Wirtschaft eines Landes und kommen durch ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage zustande. Sie wiederholen sich rhythmisch und umfassen mehrere Jahre. Sie sind nicht vorhersehbar und können zu volkswirtschaftlichen Krisen führen. Sie sind durch tiefgreifende Nachfrageveränderungen wie die Kohlekrise oder die Stahlkrise geprägt.
Strukturelle Schwankungen
Strukturelle Schwankungen treten langfristig auf und können sich über 40 bis 60 Jahre erstrecken. Sie sind durch technische und gesellschaftliche Erneuerungen bedingt. Zumeist wird das Produktionspotential durch solche Innovationen gesteigert, während der Arbeitsaufwand geringer wird. Hohe Arbeitskapazitäten werden freigesetzt und können anderweitig genutzt werden. Die Politik hat kaum eine Möglichkeit, einzugreifen. Von den strukturellen Schwankungen sind nur wenige Wirtschaftszweige betroffen. Die strukturellen Schwankungen können zu schweren Strukturkrisen führen und erfordern langfristige Anpassungsprozesse.
Indikatoren, die den Konjunkturzyklus beeinflussen können
Verschiedene Indikatoren als Messgrößen erlauben Aussagen über die konjunkturelle Lage einer Volkswirtschaft wie Deutschland. Solche Indikatoren werden nach der Zeit und nach Veränderungen von Menge oder Preis unterschieden. Mit den Indikatoren ist ein rascher Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung möglich. Die Indikatoren müssen eine hohe Aussagekraft haben, repräsentativ und theoretisch plausibel sein. In der Berechnung müssen sie statistisch angemessen sein. Die Wirtschaftsdaten müssen monatlich oder quartalsweise bereitstehen sowie über einen langen Zeitraum erhoben worden sein. In Deutschland werden die für die Indikatoren wichtigen Daten durch das Statistische Bundesamt geliefert.
Die wichtigsten Indikatoren für einen Konjunkturzyklus sind
- Mengenindikatoren wie Auftragseingänge und Arbeitslosenzahlen
Solche Mengenindikatoren sind von der Mengenentwicklung eines ausgewählten Objektes abhängig. - Preisindikatoren wie Immobilienpreise, Aktienkurse, Währungskurse und Lebensmittelpreise
Preisniveau oder Preisentwicklung können an den Preisindikatoren abgelesen werden. Damit sind Rückschlüsse auf die einzelnen Phasen möglich. - Frühindikatoren wie Aktienindex, Rohstoffindex und Lagerbestände
Frühindikatoren werden als vorauseilende oder vorlaufende Indikatoren bezeichnet. Sie informieren über die zukünftige Entwicklung der Wirtschaftslage. - Präsenzindikatoren wie Preise, Zinsen und Bruttoinlandsprodukt
Sie werden auch als Ist- oder Gegenwartsindikatoren bezeichnet und informieren über die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft. - Spätindikatoren wie Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenquote, Lohnentwicklung und Inflationsrate
Sie zeigen die wirtschaftliche Entwicklung in der Vergangenheit an.
Die Dauer des Konjunkturzyklus
Ein Konjunkturzyklus mit seinen Phasen erstreckt sich über einen längeren Zeitraum. Die einzelnen Phasen können sich über drei bis fünf Jahre erstrecken. Sie sind durch ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage geprägt. Der Konjunkturzykluskann auch kurzfristig sein. Bei saisonalen Schwankungen dauert der Konjunkturzyklus nur wenige Monate. Der Staat hat die Möglichkeit, in den Konjunkturzyklus einzugreifen, beispielsweise, um die Phasen der Rezession oder der Depression zu verkürzen. Ein wichtiges Instrument des Staates ist die Steuerpolitik. Während der Hochkonjunktur kann der Staat die Steuern erhöhen. Bei einem Konjunkturtief, in der Depression, können Steuersenkungen vorgenommen werden. Auch die Notenbanken können eingreifen, indem sie beispielsweise während der Hochkonjunktur die Zinsen erhöhen, um eine Inflation zu verhindern.
Fazit: Wirtschaftliche Lage eines Landes ist am Konjunkturzyklus erkennbar
Der Konjunkturzyklus ist durch die Phasen Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung und Tiefphase gekennzeichnet. Er bietet Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Lage eines Landes wie Deutschland. Verschiedene Indikatoren können den Konjunkturzyklus beeinflussen. Die einzelnen Phasen sind durch bestimmte Merkmale geprägt. Während des Aufschwungs verbessert sich die Auftragslage. Die Produktionskapazitäten werden besser ausgelastet. In der Hochkonjunktur sind die Kapazitäten voll ausgelastet, während die Auslastung beim Abschwung wieder zurückgeht und in der Tiefphase nur gering ist. Der Konjunkturzyklus wiederholt sich nach der Tiefphase wieder von vorn. Die Notenbanken und der Staat können den Zyklus steuern.
Unser Tipp: Bei Scalable Capital kannst Du rund 2000 ETFs von iShares, Lyxor, Xtrackers, WisdomTree und Amundi von 7:30 bis 23 Uhr für nur 0,99 € handeln und dauerhaft kostenlos besparen. Monatliche Sparraten schon ab 1 €.
Mehr zum Thema:
Konjunkturwissenkennzahlwirtschaftdigital economy